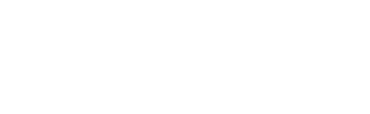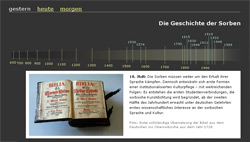Sie haben keinen eigenen Staat, keine eigene Verfassung – aber eine eigene Nationalelf. Im hintersten Zipfel Sachsens trainieren die Sorben schon jetzt: für die Fußball-EM der nationalen Minderheiten.
|
Sorbische Minderheit
Spiel im Abseits
von Esther Göbel |
„Wótče naš, kiž sy w njebjesach. Swjeć so Twoje mjeno... ale wumóž nas wot złeho. Amen.“
Kurze Stille. Frank Rietschel, Trainer der sorbischen Nationalmannschaft, wirft einen letzten Blick auf sein Handy. 17.12 Uhr, Anpfiff. Serbja Lusatia : Orzel Zlinice, die Sorben aus der Lausitz gegen die deutschsprachigen Adler aus dem polnischen Zlinice. Es ist nur ein Freundschaftsspiel, doch die sorbische Elf ist nervös. Immerhin trainieren sie hier nicht für irgendwas, sondern für die Europeada. Die Fußballeuropameisterschaft der autochthonen, nationalen Minderheiten.
Bier- und Pommesduft, sorbische Sprachfetzen und Kindergeschrei hängen über dem Platz. Deutsche Worte schieben sich nur vereinzelt dazwischen; sie wirken wie ein Versehen. Josef Schwan ist schon seit über einer Stunde da. Er hat sich schick gemacht: Grünes T-Shirt, leuchtend weiße Hose, die Farben seines Heimatvereins Grün-Weiß Horka. Der 71-Jährige ist Deutscher und der treuste Fan der Serbja Lusatia. Er spricht Sorbisch und ist bei allen Spielen mit dabei, meist auch beim Training. „Unsere Jungs sind gut vorbereitet“, sagt er optimistisch. „Die Sorben werden gewinnen, 3:2.“
Das Ziel ist klar: Viertelfinale
„Dolhi, dolhi!“, ruft Trainer Rietschel über den Rasen, „lang spielen!“ Die Sorben stürmen, verlieren oft den Ball, in der elften Minute erkämpfen sich die polnischen Adler ihre erste Torchance – Treffer zum 1:0. Rietschel bleibt ruhig und verzieht keine Miene. Die meisten Spieler seiner Elf kommen aus der Bezirksliga, viele sind zum ersten Mal dabei, Profi ist hier keiner. Nur Rietschel hat lange Zeit auf professionellem Niveau gespielt. Gerade übt er sich weiter in konzentrierter Ruhe und starrt, die Arme vor der Brust verschränkt, auf den Platz.
Trotz aller Gelassenheit: Rietschel ist ehrgeizig. Der 39-Jährige raucht nicht, trinkt nicht, ist top trainiert. Kein Gramm Fett zuviel am athletischen Körper. Er will seinen Spielern ein Vorbild sein. Und das Ziel für die nächste Europeada 2012 ist klar: Viertelfinale.
2008 fand die Europeada zum ersten Mal statt, ausgetragen von der Föderalistischen Union europäischer Volksgruppen (FUEV). Die Idee hinter dem Turnier: Eine Plattform schaffen für die mehr als 300 autochthonen nationalen Minderheiten, die in Europa leben – viele von ihnen unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit. 18 Mannschaften nutzten die Chance, so wie die Katalanen aus Spanien, die Zimbrer aus Italien, die Okzitanier aus Frankreich und – die Sorben.
Als „absoluter Nobody“ waren sie in die Schweiz gereist, erinnert sich Rietschel. „Es war ein Start aus dem Nichts, holprig ist noch milde ausgedrückt!“ Zweimal hatten sie vorher trainiert, zwei Testspiele absolviert. Das war alles. Am Ende verloren sie gegen die in Deutschland lebende dänische Minderheit. Im Viertelfinale war Schluss, trotzdem sei es eine Ehre für jeden sorbischen Spieler gewesen, sagt der Trainer.
Es geht nicht nur um Aufmerksamkeit –
es geht auch um Identität
In zwei Jahren werden die Sorben Gastgeber des Turniers sein. Rietschel freut sich schon. Denn wer als Teil einer nationalen Minderheit lebt, ohne eigene Verfassung und ohne eigenen Staat, der hat nicht viele Möglichkeiten, sich als Volk zu präsentieren. „Die Europeada ist für uns super, was Besseres gibt es doch gar nicht! Durch den Sport kannst du jeden gewinnen, jedes Kind und jeden Opa!“, sagt er.Als Schirmherrn des Tuniers haben sie Sachsens Ministerpräsidenten Stanislav Tillich angefragt, der ist auch Sorbe – und wahrscheinlich der einzige, den die Deutschen außerhalb der Lausitz kennen. Mit der Europeada soll sich das ändern.
Doch es geht nicht nur um Aufmerksamkeit. Es geht auch um nationale Identität. Egal ob in Horka, Nebelschütz oder Bautzen: Die Sorben kennen ihre Elf. Und alle fiebern mit. Das kann ein Halt sein, wenn das eigene Volk immer mehr ausdünnt. Nur 30.000 Menschen sprechen überhaupt noch Sorbisch, viele verlassen die Lausitz und finden anderswo Arbeit, in den letzten Jahren haben zwei sorbische Schulen dicht gemacht.
Halbzeit. Orzel Zlinice führen mit zwei Toren. Schweißnasse Trikots, errötete Wangen, angestrengte Blicke in der sorbischen Kabine. Die Luft ist feucht. „Ein gutes Spiel“, ermutigt Rietschel auf deutsch und erläutert die Strategie. Wenn es um Fußball geht, muss er sich manchmal mit der deutschen Sprache behelfen, einige Fachbegriffe gibt es im Sorbischen nicht. Leise flüstert er Nummer 9, Spitzname Günther Netzer, letzte Anweisungen ins Ohr. Und dann an alle: „Wir müssen jetzt kämpfen!“
„Wir haben ein gutes Spiel gemacht!“
Das ist eine Stärke von Rietschels Mannschaft: der Teamgeist. Die Sorben stehen zusammen, nicht nur auf dem Platz. Kaum einer, der nicht auf dem sorbischen Gymnasium in Bautzen war oder sich in einem der sorbischen Vereine engagiert. Kaum einer, der neben Deutsch nicht auch Sorbisch spricht. So wie Rietschel mit seinen zwei kleinen Söhnen. Oder wie Sabine, die sich zu Hause ausschließlich auf Sorbisch unterhält. Sie sitzt mit ihren Freunden am Spielfeldrand. Eigentlich ist die 18-Jährige kein Fußballfan. „Aber wenn die sorbische Elf spielt, gucke ich mir das schon an“, sagt sie schüchtern. Gerade hat sie ihr Abitur bestanden, im Herbst will sie in Leipzig Sorbisch studieren, Lehramt, „weil unsere Kultur etwas besonderes ist und auch die nächste Generation damit aufwachsen soll“, sagt Sabine bestimmt. Es fällt der angehenden Studentin nicht leicht, ihr Dorf Schönau zu verlassen. „Aber ich werde sicherlich wieder zurückkommen“, sagt sie, „die Heimat kann mir keiner wegnehmen.“
Die zweite Halbzeit läuft besser für die sorbische Elf: Als das 2:1 fällt, lächelt Rietschel kurz. Seine Mannschaft kämpft – und schafft sogar noch den Ausgleichstreffer. Doch am Ende sind die deutschen Polen besser; kurz vor Spielende kassiert die Serbska Wubranka, die sorbische Auswahl, noch ein Tor. 3:2 für Orzel Zlinice.
Günther Netzer, der im sorbischen Leben eigentlich Robert Lehnart heißt, ist geknickt, als die Mannschaft vom Platz geht. Das rote Trikot klebt nass an seiner Brust, das aufgestickte Lindenblatt in blau-rot-weiß, Symbol der Sorben, ist zerknautscht. Trainer Rietschel verlässt trotzdem zufrieden das Spielfeld und gibt seinen Jungs reihum einen Schulterklopfer. „Die anderen waren technisch besser“, sagt er, „aber wir haben ein gutes Spiel gemacht, uns gut präsentiert.“ Das ist ihm wichtig. Denn beim Fußballspiel der nationalen Minderheiten geht es nicht nur um Punkte.
Links zum Thema:
Homepage zur letzten Europeada:
www.europeada2008.net