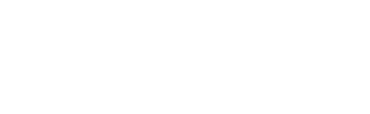Hellenen haben Zgorzelec ihren Stempel aufgedrückt: Einer von ihnen bepflastert die Stadt mit Gedenktafeln, ein anderer mit Baustellen. Ihr Wahrzeichen ist eine orthodoxe Kirche. Die Geschichte einer stillen Integration.
|
Einwanderung
Die Seele der polnischen Griechen
von Philipp Wurm |
Der Stolz der Griechen ist eine orthodoxe Kirche im Miniaturformat. Ein Stabhochspringer könnte den etwa vier Meter hohen Zwiebelturm mühelos überwinden. In dieser Kirche betet, beichtet und singt die größte griechische Gemeinde Polens. Manchmal mischen sich auch orthodoxe Bulgaren, Moldauer oder Ukrainer darunter. Doch es waren in erster Linie die Griechen von Zgorzelec, die das Gotteshaus 2002 aus Blockhölzern gebaut haben und sich mit diesem Akt endlich, nach Jahrzehnten der stillen Integration, ein Wahrzeichen erschaffen haben. Die Kirche, sie repräsentiert die rund 60 Griechen in der Stadt, auch jene, denen Jesus Christus egal ist.

Sänger Rusketos: „Die Menschen dürfen nicht vergessen, dass die Griechen diese Stadt mitgeprägt haben“ (Foto: Oliver Reinhardt)
Er verleiht seinen Landsleuten eine Stimme, im Stadtrat, in der Lokalpresse und auf der Bühne. Rusketos erzählt oft und gerne davon, wie die Griechen damals als Kriegsflüchtlinge in die Stadt zogen - in einer ersten Einwanderungswelle während des Ersten Weltkriegs und in einer zweiten Immigrationsphase Ende der 40er Jahre. Und wie die meisten von ihnen nach Hellas zurückkehrten, während einige ihrer Kinder in Zgorzelec blieben, weil ihnen polnischer Sauerkraut-Eintopf vertrauter wurde als griechischer Hirtensalat.
Die Stadtoberen hören ihm dabei zu. Denn Rusketos, der eine schwarze Zottelmähne trägt wie ein Rockmusiker aus den 70er Jahren, gilt als berühmter Mann. Er ist Sänger von Orfeusz, einer Band, die Sirtaki-Gitarren mit Herzschmerz-Melodien verbindet. Polens Costa Cordalis.
Die Sehnsucht der Eltern
Rusketos sitzt in seinem Restaurant, der „Tawerna Naoussa“, hinter sich eine Wand, an der Poster seiner Band und goldene Schallplatten hängen. „Die Menschen in Zgorzelec dürfen nicht vergessen, dass Griechen diese Stadt mitgeprägt haben“, sagt er. Seinem Einsatz als Lokalpolitiker ist es zu verdanken, dass die griechisch-orthodoxe Kirche gebaut wurde. Er war es auch, der in den vergangenen Jahren drei Gedenktafeln anbringen ließ: am Friedhof, am Gebäude der Stadtverwaltung und an einem Park im Stadtzentrum, der seit kurzem „Griechischer Boulevard“ heißt. 
Millionär Papanaum: „Mich interessieren nur meine Geschäfte“ (Foto: Philipp Wurm)
Im Norden ihres Heimatlands waren sie von alliierten und deutsch-bulgarischen Truppen eingekesselt worden. Weil der deutsche Kaiser Wilhelm II. mit dem griechischen König Konstantin I. verschwägert war, gewährte das Reich ihnen Asyl.
Als Ende der 40er Jahre der hellenische Bürgerkrieg ausbrach, geriet das mittlerweile polnische Zgorzelec zum Zufluchtsort - diesmal für einige tausend kommunistische Partisanen, die in Griechenland von den rechtsgerichteten Regierungstruppen verfolgt wurden.
Der sozialistische Bruderstaat Polen habe Zgorzelec ausgewählt, weil dort Häuser von vertriebenen Deutschen leerstanden, erklärt Rusketos.
In eines dieser Gebäude zogen seine Eltern ein. Rusketos Stimme senkt sich, als er von seinen Eltern erzählt. „Sie haben sich fremd in Polen gefühlt.“ Von der Sehnsucht nach der Sonne Griechenlands getrieben, kehrte seine Mutter Anfang der 80er Jahre zurück in den Süden. Dort hatte sich die politische Lage mittlerweile stabilisiert. „Mein Vater starb noch in Zgorzelec, aber wir haben seinen Wunsch erfüllt und ihn in Griechenland beerdigt.“
Der größte Steuerzahler der Stadt
Christos Papanaum, 63, steht am Panoramafenster seiner Villa. Er streckt die Arme aus wie ein Imperator. „Die schönste Sicht auf die Stadt weit und breit“, sagt er und lacht wie ein kleiner Junge, der beim Kindergeburtstag das größte Stück Kuchen abbekommen hat. Plattenbauten sind durch die Scheibe zu sehen, aber auch die Neiße und dahinter die Görlitzer Altstadtkulisse mit dem Rathausturm und der Peterskirche.Papanaum, Sohn einer Ende der 40er Jahre eingewanderten Griechin, hat es zu Wohlstand gebracht. Er sei der „größte Steuerzahler der Stadt“, sagt er. Ein Provinz-Donald-Trump: Ihm gehören 30 Immobilien.
Papanaum sagt: „Mich interessieren nur meine Geschäfte.“ Immerhin hat er ein paar Zlotys für den Bau der orthodoxen Kirche springen lassen: „Ich habe das Fundament und das Dach der Kirche bezahlt. Ich konnte nicht nein sagen.“ Einen Gottesdienst hat er noch nie besucht.
Seine Villa wirkt kalt und leer. Die mintgrünen Wände sind kahl, und in den Zimmern stehen nur wenige Möbel. Er sagt, er schlafe dort nur einmal pro Woche. „Bin geschäftlich viel unterwegs“, grummelt er. Die Augen hinter seiner getönten Brille sehen müde aus.
Auf die Deutschen ist Papanaum nicht gut zu sprechen. Die Renovierung des Hotels „Monopol“ in Görlitz sei sein „größter Fehler“ gewesen. „Furchtbar, furchtbar“, klagt er, die Handwerker hätten ihn „um Millionen“ betrogen. „Sie haben Rechnungen für Leistungen ausgestellt, die sie gar nicht erbracht haben.“

Gastronom Christos Faskaris: Auf der Suche nach dem Wohlstand (Foto: Oliver Reinhardt)
Manche munkeln bereits, Papanaum sei das Geld ausgegangen. Er habe sich durch die Scheidung von seiner Frau finanziell übernommen. Der Baulöwe winkt ab: „Quatsch!“ Ja, es stimmt, zehn Millionen Euro Abfindung habe er bezahlt. Aber das bricht ihm, Christos Papanaum, doch nicht das Genick.
Eine Elfjährige übersetzt die Beichte
Papanaums Geschäftssinn ist typisch für die Griechen von Zgorzelec. Schon zu kommunistischen Zeiten waren viele in gehobenen Positionen tätig, als Ärzte oder Betriebsleiter. Nach der Wende gehörten die Zgorzelecer Griechen zu den ersten, die sich mit den neuen Bedingungen arrangierten.
Die Brüder Dimitrios und Christos Faskaris, beide Gastronomen, gehören nicht dazu. Sie kamen erst in den 90er Jahren aus Griechenland nach Görlitz, in den deutschen Teil der Stadt, und eröffneten ein Restaurant und ein Eiscafé.
Die Griechen vom anderen Ufer der Neiße kennen sie kaum, von Nikos Rusketos haben sie mal gehört, Christos Papanaum ist ihnen unbekannt. Aber frommer sind sie allemal. Jeden Sonntag gehen sie über die Grenzbrücke zu der kleinen orthodoxen Kirche, auch wenn sie dort kein Wort verstehen. Denn der Priester Marek Bonifatiuk stammt aus Polen und kann gerade einmal ein paar Floskeln auf Griechisch sprechen. Den Gottesdienst hält er auf Russisch und Polnisch, um die Gemeindemitglieder aus Osteuropa einzubeziehen – Sprachen, die für die Brüder Faskaris so fremd klingen wie für Höhlenmenschen Hochlatein.
Wenn sie sich zur Beichte hinüberbeugen zum Priester, steht ihnen die elfjährige Olga bei. Olga stammt aus Moldawien, lebt seit acht Jahren in Görlitz und übersetzt das gebrochene Deutsch der Brüder ins Russische. Dimitrios und Christos Faskaris sind Außenseiter, die Griechen von Zgorzelec dagegen mittendrin in der Gesellschaft.