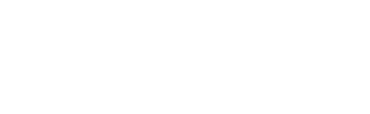Erst fraßen sich die Bagger in das Dörfchen Deutsch-Ossig, dann kam das Wasser. Übrig geblieben sind ein paar Ruinen und der größte See Sachsens. Der könnte bald Touristen aus der ganzen Region anziehen.
|
Deutsch-Ossig
Bald wieder Kohle?
von Jonas Nonnenmann |
Wo heute die Segelschule steht, starb ein ganzes Dorf: Deutsch-Ossig, sechs Kilometer südlich von Görlitz, nur einen Steinwurf entfernt von der polnischen Grenze. Kurz vor der Wende hatte Ossig noch 650 Einwohner, einen Fleischer, einen Bäcker, zwei Tante-Emma-Läden, einen Jugendclub und eine Kegelbahn. Übrig geblieben sind drei Höfe, deren Balken nur mit Mühe das Gewicht der Dächer tragen. Einsam stehen sie da und von Unkraut überwuchert, die letzten Zeugen eines verschwundenen Dorfes. Hier lebt schon lange keiner mehr.
Einer wehrte sich
Pfarrer Dieter Liebig war in den 80er Jahren einer der wenigen, die sich gegen die gefräßige Grube wehrten. Während andere in Schockstarre verfielen, predigte Liebig gegen die Verwüstung, gegen den Tagebau und gegen ein politisches System, das den Menschen ihre Heimat raubt.
Liebig dichtete eine Totenmesse für die Natur: „Brüllend drängt die Erde zu Gott im Himmel, dass einer sie hört.“ Vor allem die Stasi hörte zu: Wie Liebig Jahre später erfuhr, hat ein Bekannter ihn die ganze Zeit bespitzelt.
Heute sitzt er auf einer Holzbank am See, raucht, und seine Augenringe erzählen, dass er noch immer Nächte am Schreibtisch verbringt. Tausende von Seiten hat er produziert, darunter die zweibändige Geschichte von Deutsch-Ossig.
Als 1986 der endgültige Beschluss zum Abriss fiel, hatten viele das Dorf schon freiwillig verlassen - wegen des Rußes, des Lärms oder weil sie ihr Haus gegen eine Plattenbauwohnung getauscht hatten. Tag für Tag pusteten die Schornsteine des gegenüber liegenden Kraftwerks neuen Staub in die Luft: Die Häuser waren schwarz, die Lungen auch.
Das DDR-Regime nahm solche Nebenwirkungen in Kauf, weil Braunkohle unverzichtbar schien: Schwarzkohle gab es nur auf der anderen Seite der Mauer, das sowjetische Öl war zu teuer. Über 90 Prozent des Stroms in der DDR wurde zeitweise aus Braunkohle erzeugt.
Fällt die Kirche?
Wenigstens die Kirche wollte Liebig erhalten. „Die Kirche war ein Symbol für uns alle“, sagt er. „Wir hätten uns verbarrikadiert und gewehrt. Nicht mit Waffen, aber damit“, sagt er, breitet die Arme aus und ballt seine Hände.
Es kam anders: Nach Verhandlungen einigte man sich Mitte der 80er Jahre, die barocke Kirche abzubauen und nach Görlitz-Königshufen umzusetzen, mitten in eine Plattenbausiedlung. 1998 wurde sie neu eingeweiht. Die dortige Gemeinde freute sich: Bis dahin hatten sie ihre Gottesdienste in einem Zirkuswagen abgehalten.
„Dass das mit der Kirche geklappt hat, ist Herrn Liebigs Verdienst“, sagt Simone Drescher, eine adrett gekleidete Frau Anfang Vierzig, kurze Haare, wacher Blick. Drescher wohnte direkt gegenüber der Kirche. Heute ist sie die Vorsitzende des Vereins Altes und Neues Deutsch-Ossig, der das jährliche Treffen für die ehemaligen Einwohner organisiert.
Drescher blieb bis 1991 im Ort, da war sie Anfang Zwanzig. Die meisten waren zu dieser Zeit schon weg. „Mir ist es nicht so schwer gefallen auszuziehen“, sagt sie, „aber bei meinen Eltern war das anders. Die hatten ein altes Haus gekauft und das mühevoll umgebaut.“ An Widerstand dachten sie trotzdem nicht: „Das waren eben DDR-Zeiten“, sagt Manfred Drescher, der Vater und schaut wehmütig auf das Stück Wiese, auf der einmal sein Haus stand. „Damals wär'n wir weggesperrt worden, und dann wär' Ruhe gewesen“.
Fünf ältere Einwohner, sagt Liebig, nahmen sich das Leben. „Ich habe die Lebensmüdigkeit gespürt“, sagt er langsam mit seiner tiefen Bassstimme. 1989, im Jahr der Wende, war jeder Zweite umgezogen. Einige der Übriggebliebenen feierten Weihnachten bei Liebigs im Hausflur. Die Kirche war schon weg.
Die Wende
Dann kam die Wiedervereinigung und Liebig stand auf der Gewinnerseite. 1990 wurde er Landrat für die CDU. Plötzlich war Liebig für Tausende von Kohle-Arbeitsplätzen verantwortlich - und vollzog eine Kehrtwende: Um Arbeitsplätze zu retten, setzte er sich für eine Verlängerung der Kohleförderung ein. Fast sieben Jahre kämpfte er für die Ausweitung des Braunkohlebergbaus, doch 1997 war Schluss. Weil den Betreibern neue Umweltfilter zu teuer waren, machte das Kraftwerk, die „Dreckschleuder von Hagenwerder“ endgültig dicht und mit ihr der Tagebau.
Heute liegt die Hoffnung über der Grube. „Der See könnte touristisch ein Knaller werden“, glaubt Arndt Gundlach, Besitzer der Segelschule, und schwärmt von der Lage zwischen Landeskrone, dem Hausberg von Görlitz, und dem Isergebirge. Auch der ehemalige Fußball-Nationalspieler Jens Jeremies soll sich schon ein Grundstück am Ufer gekauft haben.
Doch die Alt-Ossiger bleiben skeptisch. „Die Fahrradfahrer hier bringen doch alle ihr eigenes Zeug mit“, sagt Simone Drescher. Und auch ihr Vater winkt ab: „Die vielen Arbeitslosen kaufen doch lieber im Supermarkt ein, als dass sie sich hier eine Bratwurst für Zweifuffzig zu kaufen. Da kriegen sie im Aldi doch 'ne ganze Packung für.“
Links zum Thema:
www.deutsch-ossig-ev.de
www.dieter-liebig.de